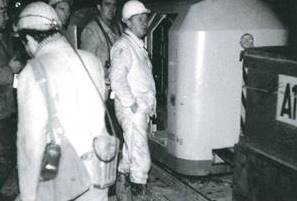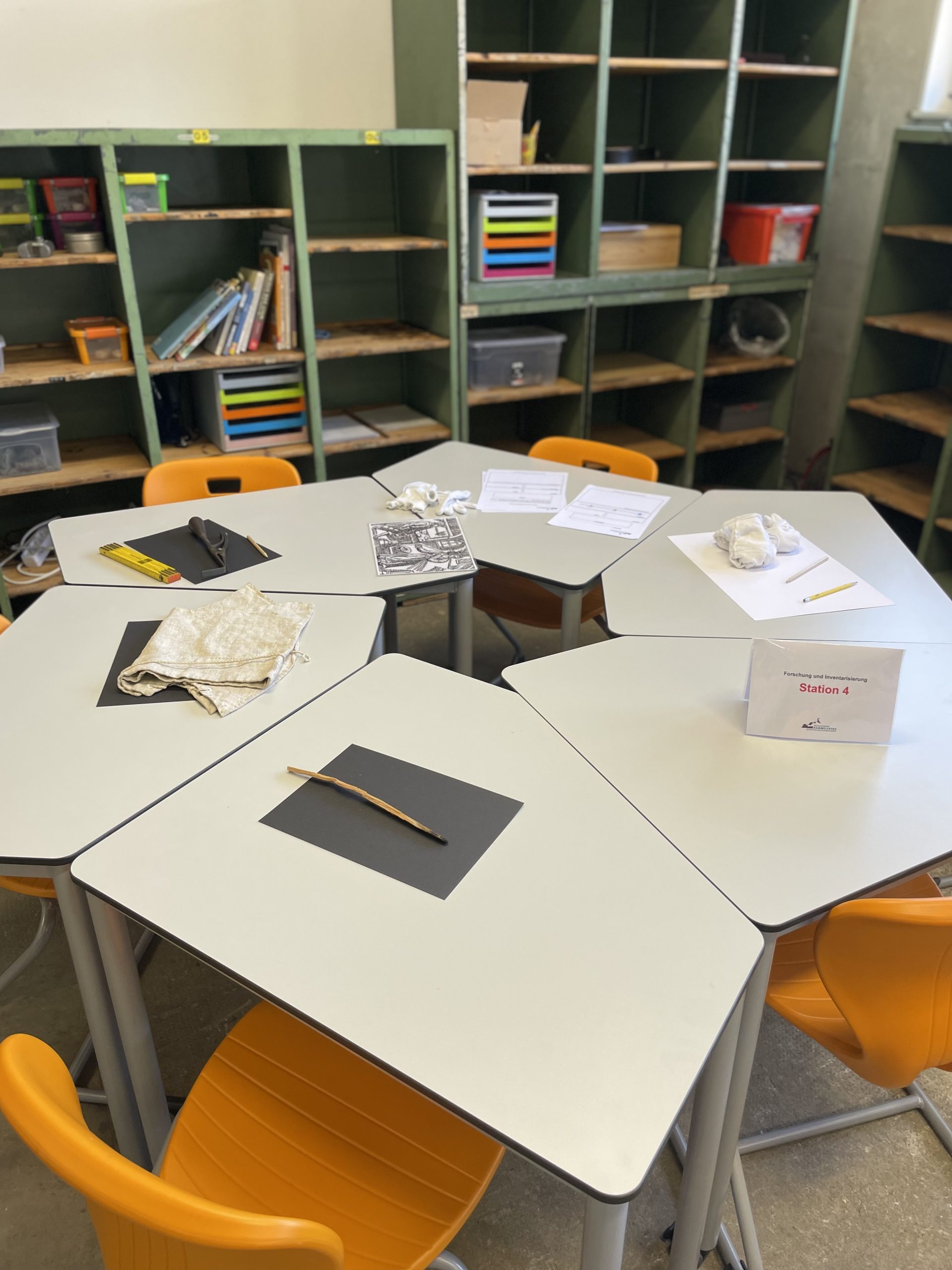Am diesjährigen Tag des offenen Denkmals, am 10. September 2023, wurde im Beisein der Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner die Sonderausstellung „Leben und Arbeiten unter Zwang: Zwangsarbeiter am Erzbergwerk Rammelsberg zwischen 1939 und 1945“ im Schwerspatraum des Weltkulturerbes Rammelsberg eröffnet.
Die Sonderausstellung wurde von Studierenden des Historischen Seminars der Leibniz Universität Hannover erarbeitet und in einer Projektwoche aufgebaut. Unter der Leitung des Historikers Prof. Dr. Karl-Heinz Schneider haben in Kooperation mit Dr. Johannes Großewinkelmann vom Weltkulturerbe Rammelsberg, Georg Drechsler von der Arbeitsstelle Montanarchäologie des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege und des Historikers Bernd Wehrenpfennig die Studierenden Ergebnisse aus einem aktuellen Forschungsprojekt zur Zwangsarbeit am Erzbergwerk Rammelsberg aufgegriffen und in der Ausstellung umgesetzt.

Das Aufbauteam der Sonderausstellung: Foto: Weltkulturerbe Rammelsberg.
Das von der Friede Springer Stiftung geförderte Forschungsprojekt „Räume der Unterdrückung: Neue geschichtswissenschaftliche und archäologische Forschungen zur Geschichte der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter am Erzbergwerk Rammelsberg“ hat die Ausgrabung der ehemaligen Standorte der Zwangsarbeiterlager und die Neubewertung von historischen Unterlagen zur Zwangsarbeit ins Zentrum der Untersuchungen gestellt. Nach der Zeit des Erinnerns durch die Befragung von Zeitzeugen, können die Ausgrabungen der Archäologen in Verbindung mit einer Neubewertung historischer Quellen der Vermittlung der historischen Zusammenhänge zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus neue Impulse verleihen. Archäologen und Historiker haben in dem Forschungsprojekt die Arbeit der Behörden, der Verwaltungen, der Betriebsleiter, der Lagerführer und der Wachmannschaften bei der Organisation der Zwangsarbeit in den Fokus gerückt. Die Studierenden des Historischen Seminars haben aus den Forschungsergebnissen einzelne Themen aufgegriffen und aus ihrer Perspektive präsentiert. Themen wie Sexualität und Freundschaften unter Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, aber auch zwischen ihnen und deutschen Arbeiterinnen und Arbeitern, sowie Hunger, Täter und Arbeitsunfälle lassen erahnen, unter welchen Bedingungen die aus ihrer Heimat ins Deutsche Reich verschleppten Menschen unter den Augen der deutschen Bevölkerung ausgesetzt waren.

Studierende und Mitarbeiter, die am Aufbau der Sonderausstellung beteiligt waren, bekommen nach der Eröffnung von Geschäftsführer Gerhard Lenz eine Sonnenblume überreicht. Foto: Weltkulturerbe Rammelsberg.
Diese Sonderausstellung vermittelt durch die Art der Inszenierung des Themas im Raum, durch zahlreiche Objekte aus der Ausgrabung, durch Installationen und Medien, auf verschiedenen Ebenen das brutale Handeln der Täter und das unvorstellbare Leiden der Opfer.

Führung durch die Sonderausstellung mit Mitarbeitern der Abteilung Besucherservice des Weltkulturerbes Rammelsberg. Foto: Weltkulturerbe Rammelsberg.
Mit der Präsentation dieser Sonderausstellung findet die Vermittlungsarbeit innerhalb des zweijährigen Forschungsprojektes, das Ende September 2023 endet, ihren Abschluss. Die Ausstellung wird noch bis Anfang kommenden Jahres gezeigt. Eine für das nächste Jahr geplante Publikation wird die umfangreichen Ergebnisse des Forschungsprojektes zur Geschichte der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter am Erzbergwerk Rammelsberg vorstellen.